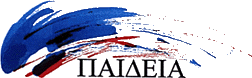Ich unternehme den Versuch, unter Rückgriff auf ein in der akademischen Philosophie
nach wie vor wenig rezipiertes Gedankengut, namentlich das Denken des französischen
Bibliothekars, Schriftstellers und Philosophen Georges Bataille (1897–1962)(1),
die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit eines positiven Bezugs zum Opferbegriff
herauszustellen; dieses Vorhaben erfordert einen Rekurs auf Hegel, insofern dieser bzw.
dessen philosophisches System Batailles Philosophieren als ständige (Negativ-)Folie und
inspirativer Fluchtpunkt dient. Was ich im folgenden als das Charakteristische und eminent
Herausfordernde des Batailleschen Denkens vorstellen möchte, ist die darin vorgenommene
eigentümliche Verknüpfung von "Opfer" und "Geist" in Gestalt der
"Verschwendung" oder – des "Opfergeistes".
Hinführung: Was aber meint das, "Opfergeist"?
(1) Die erste Antwort auf diese Frage ist unauflöslich verbunden mit Hegels
,Phänomenologie des Geistes', die gemäßer den Titel ,Phänomenologie des Opfergeistes'
tragen müßte. Geopfert wird in ihr, auf dem Altar der Dialektik, nichts geringeres als
die Welt selbst in ihrer unauflöslichen Widersprüchlichkeit, mit anderen Worten: in
ihrer unhintergehbaren Materialität und Körperlichkeit, zugunsten der Erstehung des
einen "Welt"-Geistes, dem freilich nichts mehr fremd ist – mit einer
Ausnahme: das Heilige. Dem idealistischen Opfer der Welt korrespondiert ein folgenschweres
Opfer des Heiligen in seiner rückhaltlosen Profanierung qua totaler Historisierung, die
sich manifestiert als Finalisierung, Instrumentalisierung und Rationalisierung aller
Gegenstände und Vorgänge – markant von Hegel selbst in Worte gefaßt in dem
berühmten Satz aus den ,Grundlinien der Philosophie des Rechts' von 1820: "Was
vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig."(2)
Der Preis aber für Vernunft und Aufklärung, welche die sogenannte Moderne ermöglichen,
ist das Verschwinden des Heiligen aus der Welt, welches wiederum gleichbedeutend ist mit
einem Verschwinden der Welt aus der Gegenständlichkeit, die nunmehr als zweckrationaler
Zusammenhang gedacht wird. Mit dieser Denkbewegung wird vieles möglich, was zuvor
undenkbar war; man muß sich aber im klaren sein, daß damit zugleich anderes unmöglich
wurde bzw. seither nicht oder kaum mehr gedacht werden kann.
(2) Diesem "unmöglichen" und "undenkbaren" Anderen widmet sich nun
die Antwort Georges Batailles: Die "Rückkehr des Heiligen" ist der Entzug des
Gegenstands aus der Sphäre der Dinglichkeit, erreicht im Opfer (Opfer des
"Dings" qua Opfer des Geistes) und in der bewußten, an die Grenzen des
Bewußtseins heranführenden Verschwendung. Sie führt uns erstmals in den engeren Bereich
der Religion – Religion, die für Bataille gleichbedeutend ist mit der beschriebenen
Leistung: Opferung (Zerstörung) des Dings "zum Zwecke" (hier verortet sich
zugleich auch schon ein innerer Widerspruch von Batailles ,Theorie der Religion') seiner
Restituierung an die Welt des Heiligen, verstanden als Bereich dessen, was aller
dinglichen Finalität, oder besser, aller Zweckrationalität enträt.
Rekurs: Hegels ,Phänomenologie' als "Phänomenologie des Opfergeistes"
"Seine Grenze wissen heißt, sich aufzuopfern wissen."(3)
Wie gelangt Hegel dieser zitierten Formel? Es ist evident, daß sie in Zusammenhang mit
der berühmten Herr-Knecht-Dialektik steht, die ein Kernstück der, Phänomenologie'
bildet und die vor allem in der französischen Rezeption seit Alexandre Kojève als das
Eigentliche von Hegels Philosophieren gesehen wurde. Diese Privilegierung der
Herr-Knecht-Dialektik kann man gewiß mit Recht in Frage stellen(4);
sie wird gleichwohl von einigen Beobachtungen gestützt, wie etwa der, daß diese
gleichsam dramatische Darstellung des dialektischen Denkschemas nicht nur am Ende der
,Phänomenologie' noch einmal evoziert wird, sondern auch am Anfang quasi antizipiert
– wenn es etwa an einer Stelle (von der man weiß, daß sie Batailles Hegel-Lektüre
nachhaltig geprägt hat) noch in der ,Vorrede' heißt: "Der Tod… ist das
Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die größte Kraft erfordert. (…)
Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt,
sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes."(5)
In einer bewundernswerten Strenge und Prägnanz vollzieht Hegel zum Zwecke der
jeweiligen Erklärung des einen aus dem anderen eine radikale Engführung der Begriffe
Selbstbewußtsein, Ich, Negation, Tod, Ding, Herr, Knecht, Begierde, Arbeit.
Selbstbewußtsein, die Möglichkeit des Menschen, "ich" zu sagen, verdankt sich
der Konfrontation des tätigen (= seine Umwelt qua Nicht-ich negierenden oder negieren
wollenden = begehrenden) Subjekts mit einem anderen, ebensolchen. In dieser Konfrontation
blitzt die Wirklichkeit des Todes für das Selbstbewußtsein auf, und je nachdem, wie es
sich angesichts dieser furchtbaren Wirklichkeit verhält und entscheidet, erhebt es sich
zum Herrn (qua Selbstbewußtsein für sich) oder macht sich zum Knecht (qua Bewußtsein
für ein anderes oder "Bewußtsein in der Gestalt der Dingheit"(6)).
Wahrheitsstatus(7) erlangt die Selbstgewißheit des
Selbstbewußtseins erst durch die Bewährung im Angesicht des Todes:
Die Darstellung seiner aber als der reinen Abstraktion des Selbstbewußtseins besteht
darin, sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu zeigen, oder es zu
zeigen,… nicht an das Leben geknüpft zu sein. (…) Das Verhältnis beider
Selbstbewußtsein[e] ist also so bestimmt, daß sie sich selbst und einander durch den
Kampf auf Leben und Tod bewähren.(8)
Dieser Kampf zeitigt als Resultat die Setzung eines reinen Selbstbewußtseins, welchem
Hegel den Titel "Herr" verleiht, und eines nicht reinen Bewußtseins (das ergo
kein Selbst-Bewußtsein ist), das Hegel mit der Bezeichnung "Knecht" versieht.
Mit Blick auf Bataille ist entscheidend, daß beiden ein Bezug zum Ding wesentlich ist, im
einen Fall mittelbar, im anderen gleichsam unmittelbar.(9)
Dieser Bezug wird es Bataille ermöglichen, von einer Verdinglichung des Menschen zu
sprechen, welche notwendig mit seiner Erhebung auf die Ebene des Selbstbewußtseins
einhergehe.
Durch die Arbeit des Knechtes wird dem Herrn der unmittelbare Genuß des Dings zuteil,
insofern die Widerständigkeit des Dinges vom Knecht aufgehoben wird; da dem Herrn jedoch
zugleich das Ding – im Unterschied zum Knecht, der sich in der Konfrontation mit dem
Herrn für es entschieden hat – in Wahrheit nichts ist, ist sein Genießen des Dings
(mit Lacan gesprochen) ein dummes Genießen(10), nämlich
ein solches, das auf einer abgrundtiefen Täuschung basiert. Und das ist nicht zuletzt
Hegels Pointe: Die Anerkennung, die der Herr mit dem "Sieg" im Kampf der
Selbstbewußtseine davongetragen zu haben meint, erweist sich bei näherem Hinsehen als
eine trügerische, insofern ihr die Reziprozität mangelt, sie also gar keine Anerkennung
im Wortsinn darstellt – "(n)icht ein [selbständiges Bewußtsein] ist für ihn
(den Herrn), sondern vielmehr ein unselbständiges"(11),
das des Knechtes. Dessen Partei ergreift Hegel, wenn er festhält: "Die Wahrheit des
selbständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein"(12),
denn während das Bewußtsein des Herrn mangels eines adäquaten, das heißt
anerkennungsfähigen bzw. -tauglichen Gegenübers ein für allemal auf verlorenem Posten
steht, besteht für das Bewußtsein des Knechts die Chance, "durch die Arbeit zu sich
selbst zu kommen"(13). Denn genau betrachtet, erfüllt
auch die Knechtschaft bereits die Bedingungen für das Selbstbewußtsein, die Hegel zuvor
aufgestellt hatte, hat doch auch der Knecht wie der Herr dem Tod als dem "absoluten
Herrn"(14) ins Antlitz geschaut und so das Wesen der
reinen Negativität an sich selbst "erfahren".(15)
Hegel votiert an dieser Stelle gleichsam für das knechtische Bewußtsein, er vollzieht
dessen Entscheidung gegen die Selbstaufgabe mit und redet der Arbeit des Selbst an sich
(wie des Begriffs an sich selbst) das Wort, wobei freilich die Arbeit als die
"wirkliche Auflösung des Wesens im Dienen" dabei selbst den Charakter einer
Selbstaufgabe erhält – wenn auch (und das scheint der wesentliche Unterschied zu
sein) ohne unmittelbare letale Folgen. In dieser Hinsicht ist die Arbeit des Knechts das
Äquivalent der Begierde des Herrn; sie ist "gehemmte Begierde, aufgehaltenes
Verschwinden, oder sie bildet".(16)
Soweit zur Gestalt der Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik. Bataille wird insbesondere
gegen Hegels Parteinahme für die Arbeit Sturm laufen, freilich nicht aus einem
anti-proletarischen, gleichsam rechtshegelianischen Affekt heraus (das verhindert schon
seine Ausbildung bei dem Linkshegelianer Kojève), sondern weil er im Gegenteil darin die
Urszene des modernen Kapitalismus und seiner Reduzierung aller Phänomene, einschließlich
des Menschen selbst, auf die Sphäre der bloßen Dinglichkeit erblickt, welche es
ausmacht, daß alle Gegenstände nur noch nach ihrer potentiellen Instrumentalisierbarkeit
bewertet werden – sie geraten nur noch als Mittel in den Blick, als etwas, das etwas
anderem dient, nie auch als Zweck, als etwas, das seinen Sinn in sich selbst hat, das also
souverän wäre, um hier ein Grundwort Batailles einzuführen. Er wird auch
herausarbeiten, daß diese Haltung, die er bei Hegel präfiguriert findet, implizit wie
explizit einer wachsenden Lustfeindlichkeit Vorschub leistet, die sich im Bisherigen etwa
an Hegels Definition der Arbeit als "gehemmter Begierde" festmachen ließe, und
die These aufstellen, daß die zunehmende Verdrängung von Erotik und Sexualität in
Zusammenhang steht mit einer vergleichbaren Verdrängung des Todes aus der alltäglichen
Erfahrung.(17) Und Bataille wird es auch sein, der an all
diesen Entwicklungen der Moderne ein nachhaltiges Verschwinden des Heiligen dokumentiert
und gegen sie – gegen dieses – die Grunderfahrungen von Sexualität und Tod
(etwa am Beispiel des Opfers) stark zu machen versucht, die ihm zufolge – hier stimmt
er Hegel zumindest teilweise zu – das Wesen des Menschen maßgeblich bestimmen und
die – hier setzt er sich von Hegel deutlich ab – durch keine wie auch immer
geartete Strategie des Denkens wie des Handelns auf den Begriff zu bringen respektive in
den Griff zu kriegen sind. Bevor wir uns aber endgültig Bataille zuwenden, bedarf es noch
einer Ergänzung unserer Darstellung der Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik, die deren Bezug
zur Opferproblematik verdeutlichen soll, die uns ja bei Bataille vornehmlich beschäftigen
wird.
Im weiteren Verlauf der ,Phänomenologie des Geistes' verlagert Hegel das dialektische
Geschehen zwischen Herr und Knecht, das er bislang an zwei getrennten Bewußtseinen
abgehandelt, gleichsam theatralisch inszeniert hat, in ein einziges Bewußtsein; auf einer
höheren Stufe des Geistes wiederholt sich mithin das Verhältnis von selbständigem und
unselbständigem Bewußtsein noch einmal, und diese Wiederholung ist notwendig, wenn sich
das Selbstbewußtsein denn auf das Niveau des absoluten Geistes erheben soll. Dieses wird
erreicht über die Herstellung einer Einheit der beiden verschiedenen Anteile des nunmehr
einzelnen, in sich getrennten Selbstbewußtseins; solange diese Einheit nicht hergestellt
ist, befindet sich das Selbstbewußtsein Hegel zufolge als "unglückliches
Bewußtsein" qua "Bewußtsein seiner als des gedoppelten, nur widersprechenden
Wesens".(18) Und im Zuge der Darstellung dessen, wie
sich dieser Weg des Bewußtseins zum Selbstbewußtsein jetzt innerhalb eines Bewußtseins
gestaltet, erweist sich die Hegelsche Dialektik vollends als Vollzugsform einer
Opferlogik, als die sie bislang nur implizit erschienen ist (und wo "Opfer" nur
der mögliche Name war, den die Interpretation für den unterlegenen Teil einer auf Leben
und Tod ausgetragenen Auseinandersetzung zweier Kontrahenten bzw. auch für den
Selbstverzicht in der dienenden Unterwerfung des Knechts unter den Herrn oder unter ein
durch Arbeit zu erreichendes Ziel finden konnte). Nun aber wird Hegel konkret, und damit
wird auch das Opfer als wesentliche Kategorie seiner ,Phänomenologie des Geistes'
evident: Es ist das Selbstbewußtsein selbst, das einen Teil seiner selbst opfern muß,
will es anders seine Einheit erzielen und so dem Stand des unglücklichen Bewußtseins
entfliehen.(19) Es muß sich selbst opfern (wollen), um sich
selbst zu gewinnen.
Ich kürze hier ab: Dieses Selbstopfer vollzieht sich genauerhin "(d)urch die
Momente des Aufgebens des eigenen Entschlusses, dann des Eigentums und Genusses und
endlich [durch] das positive Moment des Treibens eines unverstandenen Geschäftes",(20)
worin das Bewußtsein die Gewißheit erlangt, "in Wahrheit seines Ichs sich
entäußert und sein unmittelbares Selbstbewußtsein zu einem Dinge, zu einem
gegenständlichen Sein gemacht zu haben".(21) Und Hegel
beeilt sich festzustellen, daß allein durch "diese wirkliche Aufopferung",(22)
nämlich die konsequente Verdinglichung seiner selbst, das Bewußtsein aus seinem
unglücklichen Zustand treten und auf die Höhe der Vernunft gelangen konnte.(23)
Darauf also läuft die Hegelsche Dialektik hinaus, können wir mit Bataille festhalten:
die Vernunft zu ermöglichen vermittels der restlosen Verdinglichung des Bewußtseins
unter Verzicht auf Begierde und Genuß bzw. letztendlicher Leugnung (qua
instrumentalisierender Aufhebung) von Tod und Negativität. Das Bewußtsein opfert all
diese Grunderfahrungen menschlichen Daseins, um sich auf die Ebene des Geistes
aufschwingen zu können – in diesem Sinne ist der Geist der Hegelschen
,Phänomenologie' tatsächlich ein Opfergeist. Ist Opfer jedoch, so wird Bataille fragen,
nicht etwas ganz anderes? Stellt es nicht vielmehr so etwas wie den Kulminationspunkt
jener auf dem Altar der Dialektik geopferten Urdimensionen menschlicher Wirklichkeit dar?
Und wäre dann nicht vielleicht ein Denken, das sich ihm konsequent zuwendet, ein
tragfähiges Remedium gegen die menschenverachtenden Auswüchse einer Ökonomie, die sich
im Namen der Vernunft Aufklärung und Humanismus auf die Fahnen geheftet hat – einer
Vernunft, die in Batailles Augen so defizient gegenüber der Totalität der Welterfahrung
erscheint wie die Hegels?
Bataille: Das Opfer des Dings zur Wiederherstellung der Sphäre des Heiligen
Es ist durchaus zulässig, Batailles Werk im ganzen als eine einzige große Erwiderung
auf Hegel und die Phänomenologie zu lesen, zumal das, wie Foucault berichtet, offenbar
eine der Wirkungen war, die die Lektüre Batailles auf Studenten der Philosophie im
Frankreich der fünfziger Jahre ausgeübt hat.(24) Wir
beschränken uns jedoch im folgenden auf Batailles Ausführungen zum Opfer in seiner
,Theorie der Religion' (1948).(25)
Es genügt, Batailles Denken in seinen Grundzügen zu rekonstruieren, um damit auch
schon dessen Verhältnis zur Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik, wie wir sie oben entwickelt
haben, deutlich herauszustellen. Der Mensch ist Mensch, insofern er sich vom Tier
unterscheidet, welches "in der Welt (ist) wie das Wasser im Wasser",(26)
das heißt so, daß es kein Verhältnis von Herr und Knecht kennt, "nichts, was auf
der einen Seite Autonomie und auf der anderen Abhängigkeit begründen könnte. Die Tiere
haben, da sie sich gegenseitig auffressen, freilich ungleiche Kräfte, aber nie herrscht
zwischen ihnen etwas anderes als dieser quantitative Unterschied".(27)
Dieses fraglose In-der-Welt-Sein der Tiere impliziert, daß es für sie auch keine
Objektkonstanz gibt,(28) mithin keine Gegenständlichkeit;
ihre Welt ist eine Welt der Immanenz und der Unmittelbarkeit (29)
ohne jegliche Trennungen zeitlicher wie räumlicher Natur, ein Kontinuum also, das der
Dinglichkeit enträt: "Einzig in den Grenzen des Menschlichen erscheint die
Transzendenz der Dinge gegenüber dem Bewußtsein (oder die des Bewußtseins gegenüber
den Dingen)",(30) und sie stellt sich her vermöge der
Erfindung des Werkzeugs als der Urform des Dings, mit anderen Worten aufgrund der
Tatsache, daß der Mensch die Arbeit entdeckt.
Die Position des Gegenstands, die in der Animalität nicht vorkommt, ergibt sich aus
der menschlichen Verwendung von Werkzeugen. (…) Soweit die Werkzeuge im Hinblick auf
einen Zweck hergestellt werden, setzt das Bewußtsein sie als Gegenstände, als
Unterbrechungen in der unterschiedslosen Kontinuität. Das hergestellte Werkzeug ist die
Entstehungsform des Nicht-Ich.(31)
Mit dieser Position ist zugleich auch gesetzt, was der Welt bis anhin fremd war,
nämlich eine bestimmte Hierarchie, ein Unterordnungsverhältnis des Werkzeugs gegenüber
dem Menschen, der es verwendet. Erst dadurch kann es also zu dem kommen, was Hegel in der
Herr-Knecht- Dialektik beschreibt – es ist die Arbeit, zunächst einfach gefaßt als
Verwendung von Werkzeugen im beschriebenen Sinne, die ein Verhältnis wie dasjenige von
Herr und Knecht präformiert und ermöglicht; sie ist für Bataille nicht, wie für Hegel,
von diesem Verhältnis abkünftig, sondern konstituiert dieses vielmehr erst. Die Arbeit
hat aus Batailles Sicht die Existenz von in hierarchischen Verhältnissen gesonderten
Einzelnen zu verantworten, sie ist die Ursache von Unterordnung und Vereinzelung
schlechthin, und es mutet daher absurd an, sie wie Hegel zum Königsweg der dialektischen
Versöhnung der hierarchisch aufeinander bezogenen Elemente (zweier Bewußtseine, wie im
Falle von Herr und Knecht, oder eines einzelnen Bewußtseins, wie im Falle des absoluten
Selbstbewußtseins qua Vernunft) stilisieren zu wollen.(32)
Mit der durch die Verwendung von Werkzeugen erfolgenden Abhebung des Menschen vom Tier
geht die Negation von dessen Animalität einher, wobei Bataille unter
"Animalität" die tierischen Anteile des Menschen versteht: Sexualität und
Sterblichkeit bzw. Tod, insofern diese die Zweckrationalität der Arbeit unterbrechen. Das
ist für ihn die Geburtsstunde der zahlreichen Verbote, die genau diese beiden Bereiche
betreffen – sie alle dienen der Aufrechterhaltung eines reibungsfreien Funktionierens
des Produktionsablaufs. Indem sich der arbeitende Mensch damit selber wesentlicher
existentieller Grunderfahrungen beschneidet, reduziert er sich selber auf den Status eines
Dings: "In letzter Konsequenz gestaltet er eine Welt der Dinge, in der er selbst zu
einem Ding unter Dingen wird; eine Sache, die jedes Geheimnisses beraubt ist und fremden
Zwecken untergeordnet."(33) Während diese Sicht der
Dinge bis hierher auf eine modellhafte Verfallsgeschichte des Seins im Stile Heideggers
hinauszulaufen scheint, tritt nun bei Bataille ein Gestus auf den Plan, der auf gewisse
Weise Freuds kulturanthropologisch gewendeter These von der Wiederkehr des Verdrängten
entspricht. Das Animalische hört nämlich nicht auf, sich in der Dingwelt zweckrationaler
Zusammenhänge bemerkbar zu machen, es stört deren Funktionieren und bricht als ihr ganz
Anderes in sie ein; und genau damit öffnet sie dem eine Bahn, was Bataille das Heilige
nennt. Von menschlicher Seite gesehen, zeigt sich die sakrale Welt in der profanen auf
unbegreifliche und unbegriffliche Weise präzise dann, wenn die Verbote übertreten
werden, und das heißt nicht zuletzt im Opfer, welches Bataille als eine bewußte
Überschreitung des Tötungsverbots bzw. des Nichttötungsgebots interpretiert. Man sieht
die gegenüber Hegel völlig konträre Ausrichtung derselben Elemente: Fungiert die
Todeserfahrung bei Hegel als Ausgangspunkt, der in der Bewegung des Geistes dialektisch
überwunden wird und vermittels der Arbeit des knechtischen Bewußtseins an sich selbst
zur Heraufkunft der Vernunft führt, so ist umgekehrt bei Bataille die Todeserfahrung
– die sich im Opfer und in der Sexualität ankündigt – jenes Moment, das den
Vernunftmenschen an seine animalische Herkunft und damit an das Heilige (verstanden als
dasjenige, was sich nicht einem zweckrationalen Denken fügt, was sich nicht
instrumentalisieren, nicht bearbeiten läßt) erinnert, indem es den Lauf der profanen
Welt sistiert.
Die Kontinuität, die für das Tier von nichts anderem unterscheidbar war, die also
seine einzige mögliche Seinsweise war, brachte beim Menschen als Gegensatz zur
Armseligkeit des profanen Werkzeugs (des diskontinuierlichen Gegenstands) die ganze
Faszination der heiligen Welt hervor.(34)
Es wäre verfehlt, Bataille ob dieser Konzeption antiaufklärerischer Tendenzen zeihen
zu wollen. Er redet nicht einer naiven "Zurück zur Natur"-Bewegung das Wort,
dergestalt, daß er für eine Re-animalisierung des Menschen plädierte. Bataille hält im
Gegenteil klar fest, daß erst von der Warte der einmal konstituierten Ding-Vernunft das
Heilige als solches gesehen werden kann, welches für das Tier genausowenig existiert wie
jene. Sein Impetus ist vielmehr, auf den Abfall (im wahrsten Sinne des Wortes),(35)
den Auswurf der Hegelschen Vernunftmaschinerie hinzuweisen, darauf, was
das System aus sich ausschließen, opfern mußte, um den absoluten Geist hervorzubringen:
Das ist vor allem die Körperlichkeit oder die Welt als solche, und in Verbindung damit
die verfemten Bereiche menschlicher Erfahrung, Sexualität und Tod. Der Schauder oder die
Furcht, die wir angesichts dieser Bereiche empfinden, nicht zuletzt aufgrund der Verbote,
die sie umgeben, korrespondiert für Bataille dem heiligen Schauder, den wir vor dem
Sakralen empfinden; es besteht hier zumindest eine strukturelle Ähnlichkeit, die Bataille
interpretativ ausschöpft.
Die Empfindung des Heiligen ist offensichtlich nicht mehr die des Tieres, das die
Kontinuität in Nebeln umherirren ließ, in denen nichts unterscheidbar war. Zuallererst,
wenn es zutrifft, daß die Konfusion in der Welt der Nebel nicht zum Stillstand gekommen
ist, setzen diese der klaren Welt ihre opake Einheit entgegen. Und deutlich sichtbar wird
dies opake Etwas erst an der Grenze zum Klaren: wenigstens unterscheidet es sich von
außen von all dem, was klar ist. Andererseits fügte sich das Tier ohne sichtbaren
Protest in eine es überflutende Immanenz, während der Mensch bei der Empfindung des
Heiligen etwas wie einen ohnmächtigen Schauder verspürt. Dieser Schauder ist zweideutig.
Ohne jeden Zweifel zieht das, was heilig ist, an und besitzt einen unvergleichlichen Wert,
doch im selben Moment erscheint es plötzlich als eine schwindelerregende Gefahr für die
klare und profane Welt, das von der Menschheit bevorzugte Gebiet.(36)
Worauf will Bataille mit seiner Konzeption des Gegensatzes von sakral und profan in der
eben referierten Form hinaus? Letztlich auf folgendes: die Wiederherstellung der Würde
des Menschen, seiner Souveränität, die er mit seinem Eintritt in die Welt des Werkzeugs,
der Dinge, der Arbeit und der Produktion eingebüßt habe. Das Remedium der Negation
seiner selbst,(37) mit der der Mensch sich den Aufstieg in
die Welt der reinen Vernunft und des absoluten Geistes erkauft hat, erblickt Bataille im
Opfer als einer Praxis der Verschwendung und der (sinnlosen) Verausgabung im Unterschied
zur anhäufenden Produktion.
Prinzip des Opfers ist die Zerstörung; doch obgleich diese bisweilen sogar
vollständig sein kann (wie beim Brandopfer), ist die Zerstörung, die das Opfer bewirken
will, nicht die Vernichtung. Das Ding – und nur das Ding – soll im geopferten
Tier zerstört werden. Das Opfer zerstört die in der Realität existierenden Bande der
Unterordnung eines Gegenstands, es entreißt das Opfertier der Welt der Nützlichkeit und
gibt es einer Welt kapriziöser Unbegreiflichkeit zurück.(38)
Die Folie für Batailles Opfertheorie bildet, wie an dieser Definition ersichtlich
wird, das Opferritual der primitiven oder besser, archaischen Religionen, dessen oben
beschriebenen Sinn er als auch für alle späteren Opferhandlungen maßgeblich erachtet,
wodurch alle geschichtlichen Transformationen, Subtilisierungen und letztlich
Sublimierungen der Opferpraxis in den einzelnen Religionen ihm nur als eine Bewegung
erscheinen können, die von der eigentlichen, der ursprünglichen Bedeutung des Opfers
wegführen und diese verwässern. Obwohl Batailles Denkweise in dieser Hinsicht also
radikal ahistorisch und von daher kritisierbar ist, wollen wir jede dahingehende Kritik
für unseren Zusammenhang zurückstellen und ihm die Gültigkeit seines Opferbegriffs
gleichsam heuristisch zugestehen, um uns möglichst vorurteilsfrei der Frage widmen zu
können, was dieser Begriff leistet und inwiefern er vor dem Hintergrund des bislang
entwickelten Szenarios zwischen Hegel und Bataille für uns heute relevant sein könnte.
Das Opfer erscheint in Batailles Blick als eine Praxis, die dazu angetan ist, den
Menschen seiner Verstrickung in die alles bestimmenden Gesetzmäßigkeiten der Produktion
qua Anhäufung von Ressourcen zu entreißen, indem sie ihm mit dem Tod des Opfertieres die
Möglichkeit einer sinnlosen Verschwendung der angehäuften Ressourcen vor Augen führt
– eine sinnlose Praxis also, deren evidente Sinnlosigkeit den Sinn hat, den Kreislauf
oder besser, die Spirale der ins Unermeßliche wachsenden und zusehends alle Bereiche des
Lebens vereinnahmenden Produktion zu unterbrechen. Im Hintergrund dieser Konzeption des
Opfers steht das, was Bataille die "allgemeine Ökonomie" nennt im Gegensatz zur
"beschränkten Ökonomie", die in seiner Diktion unseren gebräuchlichen
Ökonomie-Begriff bezeichnet, mithin alles, was von einer Theorie des Mangels ausgehend
die Unumgänglichkeit von immer mehr Arbeit, immer mehr Kapitalanhäufung und immer
steigender Produktion quasi ontologisch festschreibt. Dem hält Bataille mit seiner
allgemeinen Ökonomie eine Theorie des Überflusses entgegen, die er kosmologisch
begründet: So wie die Sonne ihre Energie nicht speichert, sondern sie ohne Erwartung
einer Gegenleistung, ohne also in eine Zweck-Mittel-Relation eingetreten zu sein,
rückhaltlos verausgabt und damit erst das Leben auf der Erde ermöglicht, so verfügt
auch der Mensch aufgrund seiner (von der Sonnenenergie gespeisten) Animalität über einen
Kräfteüberschuß, den er jedoch mit seiner totalen Ausrichtung auf Arbeit und Tätigsein
im Dienste einer dinghaften Nützlichkeit negiert und verdrängt. Einzig in Sexualität
und Tod bewahrt sich ihm ein Gedächtnis dieses seines abundanten Seins, das er deshalb
gerade in diesen Bereichen mit Verboten aller Art restringiert. Dennoch bricht die
überschüssige Energie von Zeit zu Zeit hervor, und ihre Eruptionen sind umso heftiger,
das heißt gewalttätiger und zeitigen mithin umso fatalere Wirkungen, je mehr ihre wahre
Natur verkannt bzw. geleugnet wird. Daher, so Bataille, müsse es immer wieder Zeiten
geben, in denen der gewohnte Lauf der Arbeit und der Produktion unterbrochen wird, Zeiten
des Festes und der Feier – und es sind in erster Linie die Religionen, die für die
Einhaltung dieser Zeiten sorgen, in denen die profane Welt stillsteht und das Sakrale zur
Sprache kommen kann. Denn das Sakrale ist nichts anderes als dies: rückhaltlose
Verausgabung und sinnlose Verschwendung, wie sie besonders im Opfer praktiziert werden.
Das Opfer, in dessen Verlauf stets die Wirklichkeit des Todes aufleuchtet, auch wenn es
nicht tatsächlich zum Tod des Geopferten führt, wird so in Batailles Denken zum
mächtigsten Zeichen gegen die Universalisierung einer unheiligen, partikulären
Ökonomie, welche im Namen der Vernunft die Menschen ihrer Menschenwürde beraubt und sie
zusehends verdinglicht.
Die Macht, die dem Tod generell zukommt, wirft Licht auf den Sinn des Opfers, das in
seinem Vorgehen dem Tod insofern gleicht, als es einen verlorengegangenen Wert gerade
durch Preisgabe dieses Wertes restituiert. Doch ist der Tod nicht notwendig mit dem Opfer
verbunden, und noch das feierlichste Opfer kann einen unblutigen Verlauf nehmen. Das
Töten stellt nur einen tieferen Sinn klar heraus. Worauf es im Grunde ankommt, ist, von
einer dauerhaften Ordnung, in der alles Verzehren der Ressourcen der Notwendigkeit zu
dauern untergeordnet ist, übergehen zu einer Gewalt der bedingungslosen Verzehrung…(39)
Die Forderung nach einer derartigen Verzehrung, die dem zweckrationalen Denken enträt,
ist einlösbar nicht nur im Tod (des Opfertieres), sondern sie verwirklicht sich etwa auch
in der Sexualität des Menschen, insofern darunter der animalische Anteil der Begierde des
Menschen zu verstehen ist und nicht der Beischlaf zum Zwecke der Fortpflanzung. Bataille
zufolge äußert sich der Überschuß des Lebens, der die Welt des Heiligen kennzeichnet,
gerade umgekehrt darin, daß der Mensch im Gegensatz zum Tier keine instinktiv festgelegte
Paarungs-, Brunft- und Brutzeit kennt, sondern daß seinem zeitlich uneingeschränkten (es
sei denn, durch die Restriktionen der Produktionswelt behinderten) sexuellen Begehren, dem
nachzugehen ihm Lust bereitet, gleichsam als dessen zunächst unbeabsichtigter Exzeß die
Nachkommenschaft entspringt. In diesem Sinne ist gerade auch die menschliche Sexualität
verschwenderisch, sie erschließt sich naturgemäß keiner Planung und keiner Berechnung(40)
und – sie stellt Intimität her, das heißt sie negiert die arbeitsbedingte
Vereinzelung und Isolierung des Menschen, indem sie ihn sich auf den Anderen hin öffnen
läßt; sie initiiert wahrhaftige Kommunikation.(41) Auch
das ist nach Bataille also eine Leistung des Opfers: Intimität und Kommunikation zu
ermöglichen.
Das Opfer ist die Antithese zur Produktion… (…) Intim im starken Sinn ist
etwas, das über die Aufwallung einer Abwesenheit von Individualität verfügt…
(…) Das getrennte Individuum ist gleichen Wesens wie das Ding, oder richtiger, das
ängstliche Bangen um persönliche Fortdauer, das seine Individualität erst setzt, geht
einher mit der Integration seines Daseins in die Welt der Dinge. Mit anderen Worten, die
Furcht zu sterben, hängt aufs engste mit der Arbeit zusammen, setzt doch auch letztere
das Ding voraus und umgekehrt.(42)
In Passagen wie diesen erkennt man unschwer den Bezug auf Hegel und die gleichzeitige
Kritik an ihm. Nun ist Bataille aber, wir haben es schon angedeutet, kein Vertreter eines
naiven Bekehrungsdenkens – es geht ihm nicht darum, dem in der profanen Welt
gefangenen Menschen das Bild einer verlorengegangenen heiligen Welt vorzuhalten und ihn
dazu bewegen zu wollen, von seinem eitlen Tun doch abzulassen und sich dem Eigentlichen
zuzuwenden. Sein Denken ist vielmehr ein durch und durch dualistisches; es will nicht
dafür plädieren, der Mensch müsse die Ebene des Geistes, die er durch das Opfer der
Welt qua animalischer Immanenz oder Intimität erreicht habe (wofür Hegels
,Phänomenologie' die adäquate Beschreibung liefert), wieder verlassen und auf die Stufe
bewußtloser Tierheit zurückkehren. Es will jedoch in einer Zeit wie der unsrigen, die in
allen Lebensbereichen vom kapitalistischen Denken regiert wird (und in dieser Hinsicht ist
Bataille, obwohl 1962 gestorben, durchaus noch unser Zeitgenosse, ja, seine Aktualität
hat sich vermutlich sogar sukzessive gesteigert), auf jene Dimensionen des menschlichen
Daseins hinweisen, die dessen Prinzipien per se entraten, und sie kontrapunktisch zum
Zeitgeist betonen. Insofern er dazu Begriffe wie das Heilige und das Opfer bzw.
Erfahrungsbereiche wie die Religion aufgreift und verwendet, wird sein Denken umso
interessanter und herausfordernder für den Religionsphilosophen.

|